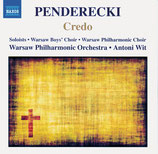Penderecki, Credo & Cantata
Penderecki, Credo & Cantata
Musik-CD, Spielzeit: 57 min.
Artikelnummer: PDC
Kategorie: Studentenlied
9,99 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
- 0,1 kg
- verfügbar
- 1 - 3 Tage Lieferzeit1
Produktinformation
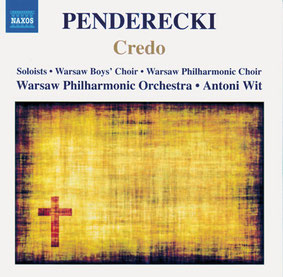
Krzysztof Penderecki, Credo & Cantata
1–9 Credo (1998)
10 Cantata in honorem Almae Matris Universitatis Iagellonicae sescentos abhinc annos fundatae (1964)
Künstler: Iwona Hossa, Aga Mikolaj, Ewa Wolak, Rafael Bartminski, Remigiusz Lukomski, Warsaw Philharmonic Choir & Orchestra, Antoni Wit
Wollte man seine Preise, Orden und Ehrungen aufzählen – diese Doppelseite würde nicht reichen. Er war einer der erfolgreichsten und am meisten bewunderten Komponisten der europäischen Nachkriegszeit – vielleicht auch einer der aufregendsten, aber das bleibt freilich eine Frage der subjektiven Wahrnehmung.
Der Pole Krzystof Penderecki starb am 29. März 2020 in Krakau, vier Monate nach seinem 86. Geburtstag. Seine Heimatstadt war die hundert Kilometer weiter östlich gelegene Provinzstadt De˛bica, doch Krakau wurde für ihn zum Ausgangspunkt. Hier studierte er an der Musikakademie, deren Rektorat er später für 15 Jahre innehatte, und hatte daneben an der Jagellonenuniversität Philosophie, Kunstgeschichte und Literaturgeschichte inskribiert. Und er war noch keine 30, als er sich in die erste Reihe der zeitgenössischen Komponisten förmlich katapultierte: „Anáklasis“ (altgr.: Biegung, Brechung), ein Werk für Streichorchester und Schlaginstrumente, erregte 1960 international Aufsehen und begründete eine sechs Jahrzehnte währende ungebrochene Karriere.
Schon hier verwendete er Klangfiguren, die für sein Schaffen typisch wurden: Cluster und Glissandi. Beides hat er nicht erfunden, sondern übernommen, aber zu besonders markanten Ausformungen geführt. Als Cluster – (Ton-)Trauben – bezeichnet man das gleichzeitige Erklingen mehrerer nebeneinander liegender Töne, so dass kein konkreter Ton mehr erkennbar ist; als Glissando – Gleiten – das übergangslose Verbinden zweiter Tonhöhen über sämtliche dazwischen liegenden Töne.
Penderecki war – ähnlich seinem älteren, ähnlich erfolgreichen ungarischen Kollegen György Ligeti (1923–2006) – getrieben von der Suche nach neuen Klangmöglichkeiten. Dabei scheute er vor Experimenten nicht zurück, die auf ein konventionelles Publikum schockierend wirken mussten, wie Knirschen, Zischen, Sägen oder das Geklapper von Schreibmaschinen. Doch tat er im Grunde nichts anderes, als alle Möglichkeiten akustischer Äußerung seinem Werk systematisch nutzbar zu machen – man könnte auch von einer Erweiterung des Geräuschbegriffes sprechen.
Natürlich war er ein Avantgardist, wenn es darum ging, neue Ausdrucksformen zu finden. Seine „Klangflächen“ und „Klangbänder“ standen strukturell alternativ zur sogenannten „seriellen“ Technik vieler seiner Zeitgenossen. Doch formell und thematisch folgte er der Tradition. Er schrieb Sinfonien, Sonaten, Konzerte und Quartette und bekannte sich auch zur musikdramatischen Form der Oper, wobei er stets aus der Weltliteratur schöpfte: „Die Teufel von Loudon“ – ein Welterfolg – beruhen auf einem Roman von Aldous Huxley, „Paradise Lost“ folgt einem Epos von John Milton, „Die schwarze Maske“ hat ihren Urheber in Gerhard Hauptmann und „Ubu Rex“ greift auf eine Groteske des Alfred Jarry zurück.
Dass er dazu noch ein erfolgreicher Filmkomponist war, beweist seine mediale Vielfältigkeit. Von ihm stammen Teile der Musik zu William Friedkins „Der Exorzist“ und zu Stanley Kubricks „Shining“, womit er, meist unbewusst, auch vielen Hörern bekannt wurde, die den Konzertsaal eher selten aufsuchen. Andrzej Wajda bediente sich seiner bei dem oskarnominierten Filmdrama über „Das Massaker von Katyn“.
Als gläubiger Katholik schuf er auch eine Reihe geistlicher Werke, aus denen die 1966 für Münster entstandene „Lukaspassion“ und das seiner vielfach geprüften Heimat gewidmete „Polnische Requiem“ herausragen, worin er polnische Schicksalsereignisse von Auschwitz bis zur Solidarnosc-Bewegung verarbeitete. Der Musikwissenschafter Gerhard Pätzig bezeichnete es als „Zentralwerk aller Totenklagen des 20. Jahrhunderts“. Auf den Tod Karol Wojtyłas, des polnischen Papstes Johannes Paul II., reagierte er 2005 mit einer „Ciaccona“ für Klavier. Nicht religiös unterfüttert, aber von tiefem Humanismus geprägt sind sein der Opfer von Hiroshima gedenkendes Streicherstück „Threnos“ (altgr.: Totenklage) von 1960 und das unter dem Einruck des Twin-Towers-Attentats geschriebene Klavierkonzert „Resurrection“ von 2001.
Ein vergleichsweise kleines Werk ist jenes, das er der Krakauer Universität gewidmet hat. Es gehört seiner frühen Schaffensperiode an, denn es entstand schon 1964 zum 600. Gründungstag der Hohen Schule, worauf auch der sperrige Titel verweist: Cantata in honorem Almae Matris Universitatis Iagellonicae sescentos abhinc annos fundatae (Kantate zu Ehren der Gründung der Jagellonen-Universität vor nunmehr 600 Jahren). Uraufgeführt wurde es im Rahmen der Jubiläumswoche am Abend des 10. Mai 1964 in der Krakauer Philharmonie.
Das sechseinhalbminütige Stück für zwei Chöre und Orchester ist typisch für Pendereckis Klangfindungen der frühen Jahre. Der gesamte Text beschränkt sich auf einen – dem Titel fast identischen – Huldigungssatz: Almae Matris universitatis Iagellonicae in honorem ob eius sescentesimum annum maxima cum devotione ei offero. (Der Jagellonen-Universität bringe ich dieses [Stück] mit höchster Verehrung zu ihrem 600. Jahr entgegen.) Diese persönliche Widmung wird teils geflüstert und gesprochen, teils gerufen und geschrien, also mit aller denkbaren klanglichen Emotion offeriert. Man mag dazu bedenken, dass zum Zeitpunkt des Jubiläums die Schreckensjahre der deutschen Besetzung noch keine zwei Jahrzehnte zurücklagen, während derer auch die Universität geplündert wurde und ihr weiterer Bestand in Zweifel stand. Pendereckis Jubelkomposition ist also durchaus als Triumph des Bestehens zu begreifen, und mit den gewaltigen Bass-Schlägen am Beginn und zum Abschluss erscheint sie wie ein akustischer Ring oder Reifen, der gleich einem Endlosband wieder zu seinem Anfang zurückkehrt.
aus: SK 2020/4