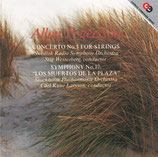Pettersson, Sinfonie No. 12 / Concerto No. 1 for Strings
Allan Pettersson, Sinfonie No. 12 / Concerto No. 1 for Strings
Musik-CD, Spielzeit: 54 min.
Swedish Radio Symphony Orchestra
Artikelnummer: PS12
Kategorie: Studentenlied
16,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
- 0,1 kg
- verfügbar
- 1 - 3 Tage Lieferzeit, bei vorbestellbaren Titeln siehe Artikelbeschreibung.1
Produktinformation
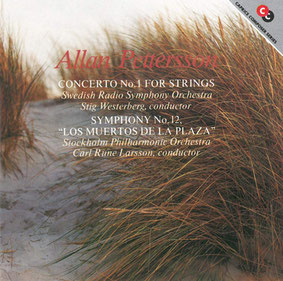
Allan Pettersson, Sinfonie No. 12 / Concerto No. 1 for Strings
Musik-CD, Spielzeit: 54 Minuten
Swedish Radio Symphony Orchestra
Zahlreiche Tänze jeglicher Art wurden für das Studententum geschrieben. Auch Märsche, Fantasien, Suiten, Ouvertüren, Rhapsodien und Kantaten. Aber eine ganze Sinfonie? Nun, es gibt eine solche,
in denen bruchstückhaft studentenmusikalische Motive vorkommen – aber gleich ein ganzes Werk? Und doch, auch das liegt vor, und es stammt aus jüngerer Zeit. Es handelt sich um die
12. Sinfonie des schwedischen Komponisten Gustaf Allan Pettersson (1911–1980).
Nicht weniger als 17 hat er zwischen 1950 und 1980 geschrieben, die erste und letzte blieben Fragment. Seine 12. entstand 1973/74 und ist eigentlich ein Chorwerk. Das ist in der neueren Musik
nicht ungewöhnlich. Sehen wir einmal von Beethovens 9. ab, hat von den späteren Sinfonikern schon Gustav Mahler die menschliche Stimme solistisch und chorisch in seinen Symphonien eingesetzt (2.,
3., 4. und 8.), und Dimitrij Schostakowitsch folgte ihm darin (2., 3., 13. und 14.). Vor allem seine 14. kann strukturell als Vorbild für Pettersson betrachtet werden, ist sie doch eigentlich ein
Gedichtzyklus nach Texten von Lorca, Rilke, Apollinaire und (dem bei uns kaum bekannten Puschkin-Zeitgenossen) Küchelbecker. Der schwedische Komponist nützte für sein Werk nur einen einzigen
Autor: den Chilenen Pablo Neruda (1904–1973), der kurz zuvor den Nobelpreis für Literatur erhalten hatte. Die so entstandene Chorsinfonie mit dem Untertitel „Los muertos de la plaza“ (Die Toten
auf dem Marktplatz) ist eine Folge von neun Gedichten aus seinem „Canto general“.
Was aber ist an dem Werk studentisch oder akademisch? Dreierlei: Der Auftraggeber, der Anlass der Komposition und das Publikum der Uraufführung. Denn die Sinfonie war die offizielle Festmusik zum
500. Gründungstag der traditionsreichen Universität von Uppsala im Jahr 1977.
Der Dirigent Carl Rune Larsson (1923–1989) war dort ab 1967 Musikdirektor. Im Frühling 1973 erbat er mit Blick auf das näher rückende große Universitätsjubiläum Pettersson um ein Werk „mit
Aktualität in einem tieferen Sinn“. Pettersson nahm sich daraufhin Gedichte aus dem „Canto general“ (wörtlich: Allgemeiner Gesang; im Deutschen auch: Großer Gesang), einem der großen lyrischen
Zyklen Nerudas aus den Jahren 1938 bis 1950, zur Vorlage und begann sofort mit der Arbeit. Im Januar 1974 war das Werk fertig, also drei Jahre vor dem bestimmten Anlass, bei dem es dann unter
Larssons Dirigat uraufgeführt wurde.
Pablo Nerudas Canto General umfasst mehr als 200 Gedichte, insgesamt 15.000 Verse in 15 Gruppen. Die von Pettersson gewählten neun Gedichte bilden die fünfte Gruppe. Der Titel „Los muertos de la
plaza“ ist jener des ersten Gedichtes und bezieht sich auf das Massaker auf der Plaza Bulnes in der chilenischen Hauptstadt Santiago am 28. Januar 1946: Bei einer Demonstration streikender
Arbeiter, an der Neruda als kommunistischer Abgeordneter teilnahm, wurden sechs Demonstranten von der Polizei erschossen und zahllose von Polizeihunden verletzt.
Pettersson, der selbst aus den untersten Gesellschaftsschichten kam, sich unter schwierigsten Umständen zum freischaffenden Künstler hocharbeitete und immer in wirtschaftlich knappen
Verhältnissen lebte, erklärte die Wahl dieser Texte ausdrücklich als Teil seines Engagements für die „kleinen Leute“ und wollte sie nicht politisch, sondern allgemein menschlich verstanden
wissen. Dieser humanistische Ansatz ist weder seiner Musik noch Nerudas Lyrik abzusprechen, trotzdem sind zumindest die Gedichte von ihrem historischen Kontext nicht zu trennen und damit hoch
politisch. Diese politische Brisanz konnte auch Pettersson nicht hinweg komponieren.
Das um so weniger, als zur Zeit der Komposition, also gerade einmal ein halbes Jahrzehnt nach den studentischen Revolten des Jahres 1968, das Thema Chile zumindest in der linken Studentenschaft
Europas höchst aktuell war. Während Pettersson Nerudas Texte komponierte, wurde in Chile der sozialistische Präsident Allende gestürzt und nahm sich das Leben; danach übernahm eine
Militärdiktatur die Macht; zwölf Tage später starb Neruda, der als Kandidat der kommunistischen Partei 1970 zugunsten Allendes auf seine eigene Kandidatur verzichtet hatte, unter zweifelhaften
Umständen. Zeitgleich komponierte auch der Grieche Mikis Theodorakis im Pariser Exil, wohin er sich vor der griechischen Militärdiktatur zurückgezogen hatte, ein Oratorium nach Texten aus Nerudas
„Canto general“. Politischer konnte ein künstlerischer Schaffensprozess also gar nicht konotiert sein.
Und dennoch: Hier treffen sich zwei Welten. Auf der einen Seite die konkrete politische Situation mit ihrer weltweiten Wirkung, die zumindest den politischen Diskurs einer ganzen akademischen
Generation geprägt hat. Und auf der anderen Seite ein introvertierter Künstler mit seiner sozialen Verantwortung und seinem eigenen Leid: Während der Komposition war er bereits von einer
lähmenden Arthritis gezeichnet, die seine Bewegungsfähigkeit letztlich völlig zerstören sollte.
Das über 50 Minuten dauernde Werk mit seinen blutigen Texten ist ein Aufschrei, eine zutiefst emotionelle Anklage und Friedensmahnung ohne jeden resignativen Gestus. Der Musiktheoretiker Rasmus
van Rijn spricht von einem „Requiem für die Unterprivilegierten“, der Publizist Andreas K. W. Meyer nennt es eine „gewaltige Menschheitsklage“. Pettersson selbst betonte die Symbolhaftigkeit der
Namen und Orte und ihre universelle Bedeutung. Seine Tonsprache ist kraftvoll und kolossal, Forte dominiert die neun durchkomponierten Sätze, die von einer permanenten Spannung beherrscht werden,
der Schluss gerät zu einer monumentalen Coda im Marschrhythmus und endet visionär in dem Wort vom „Tag der Gerechtigkeit … diesem endlosen Tag“.
Pettersson hat während der 50er-Jahre in Paris bei den Größen seiner Zeit studiert, bei Messiaen, Honegger, Milhaud und Leibowitz, wurde aber nie deren Jünger, sondern entwickelte einen eigenen,
der Avantgarde ausweichenden Stil. Er wurde zu Lebzeiten hoch gehandelt, geriet aber nach seinem Tod schnell wieder in den Schatten und erscheint nur mehr selten in heutigen Konzertprogrammen,
selbst in Schweden. Der Intensität und Bedeutung seines Werkes tut das keinen Abbruch.
„Die Toten auf dem Marktplatz“, Petterssons 12. Sinfonie, sind zwar ein sehr persönliches Werk, sie sind aber über den Willen ihres Schöpfers hinaus auch ein Zeitkommentar. Sie heben den am
Beispiel Chiles ausgetragenen Dissens um den Konflikt zwischen institutioneller Macht und individueller Freiheit auf Konzertniveau. Und damit sind sie – vielleicht im Sinne von Larssons Idee
einer tiefsinnigen Aktualität – auch ein künstlerischer Nachhall der 68er.
aus: SK 2/2018